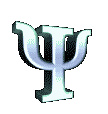Einen weiteren Anlauf, Effekte des Fernheilens bei Herzleiden zu sichern, unternahm 1998 ein neunköpfiges Medizinerteam vom Saint Luke´s Hospital des Mid America Heart Institute (MAHI) in Kansas City, unterstützt von der kardiologischen Abteilung der dortigen Universität sowie der Abteilung für Präventivmedizin der Universität San Diego, unter Leitung von William S. Harris. Dazu wurde die zweitgrößte Patientenstichprobe zusammengestellt, die es je
bei einem Heilertest gab: über tausend. Einbezogen wurden sämtliche Patienten, die innerhalb eines Jahres in die Herzklinik aufgenommen wurden. (Nachträglich aussortiert wurden lediglich Patienten, die entweder bereits für eine Herztransplantation vorgesehen waren - was von vornherein einen längeren Klinikaufenthalt erwarten ließ - oder sich weniger als einen Tag lang in der Klinik aufhielten.) Je nach der Endziffer der Nummer ihres Arztberichts wurden sie, ohne ihr Wissen, einer von zwei
Gruppen zugeteilt: Bei gerader Endziffer kamen sie in die "Gebetsgruppe", bei ungerader Endziffer in eine Gruppe, die ausschließlich konventionell versorgt wurde. Die Zuteilung nahm die Sekretärin des Krankenhausgeistlichen vor, die keinerlei Kontakt zu den an der Studie beteiligten Ärzten und Wissenschaftlern hatte. So kamen innerhalb von zwölf Monaten 1013 Versuchspersonen zusammen: 484 in der Gebetsgruppe, 529 in der Kontrollgruppe, mit einem Männeranteil von 66 bzw. 61 Prozent
und einem Durchschnittsalter, das in beiden Gruppen bei 66 Jahren lag.
Byrd hatte seine Patienten vorweg befragt, ob sie überhaupt damit einverstanden sind, dass für sie gebetet wird; von 450, die ursprünglich zur Teilnahme an der Studie eingeladen worden waren, lehnten daraufhin 57, also 12,7 Prozent ab, "aus persönlichen Gründen oder religiösen Überzeugungen" oder anderen Motiven. Harris hingegen verzichtete von vornherein darauf, solche "informierte Zustimmung" (informed consent)
einzuholen: Sie erschien ihm überflüssig, da Beten vielleicht nicht nützen, zumindest aber nicht schaden konnte. Außerdem wollte er keinerlei Vorauswahl treffen, welche die Zusammensetzung der Stichprobe womöglich unbemerkt verzerren (bias) könnte. "Allein schon das Einholen einer Zustimmung", gibt Harris zu bedenken, "könnte manche Patienten verängstigen. Wüssten sie von der Studie, so könnte sie die Möglichkeit bekümmern, dass sie nicht zur Gebetsgruppe gehören.
Andererseits könnte es mancher unreligiöse Patient als Zumutung empfinden, dass ihm ein Gebetsangebot gemacht wird, zumal in Anbetracht der Schwere seiner Erkrankung."
Und nicht nur bei den Patienten, sondern auch beim medizinisch-wissenschaftlichen Personal trieb Harris die "Verblindung" auf die Spitze: Während bei Byrd allen Mitwirkenden klar war, dass eine Fernheilstudie lief - auch wenn sie im Dunkeln tappten, wer betend fernbehandelt wurde und wer nicht -,
wussten die Beteiligten an der Harris-Studie nicht einmal so viel.
Sobald ein neuer Patient in die Studie einbezogen worden war, griff die Sekretärin, die auch die Gruppenzuteilung vornahm, zum Telefonhörer und verständigte den Leiter eines von 15 "Fernheilteams". Deren Mitglieder hatten Harris und seine Mitarbeiter in den Monaten zuvor durch persönliche Kontakte in Kansas City gewonnen. Als Fernheiler in Frage kam, wer folgende Bekenntnisse unterschreiben konnte: "Ich
glaube an Gott. Ich glaube, dass Er ein personales Wesen ist, dem jedes einzelne Leben am Herzen liegt. Ferner glaube ich, dass Er für Fürbitten um die Heilung von Kranken empfänglich ist." Einer Glaubensgemeinschaft brauchten die Fernheiler nicht anzugehören. Insgesamt 75 wurden auf diese Weise rekrutiert, allesamt Christen verschiedener Herkunft, zu 87 Prozent Frauen, dirchschnittlich 56 Jahre alt. Aus ihnen wurden nach dem Zufallsprinzip 15 Teams mit jeweils fünf Mitgliedern
zusammengestellt, die einander nicht kannten. Koordiniert wurden sie von einem Mitglied, das die Sekretärin zum "Leiter" bestimmte.
Stand ein neuer Patient zur Gebetsheilung an, so wurde einem Teamleiter mitgeteilt, wie dessen Vorname lautete - nichts weiter. Byrd hingegen hatte seine Fernheiler über die Diagnose sowie das Allgemeinbefinden informiert und zwischendurch immer dann benachrichtigt, wenn sich der Zustand des Fernbehandelten nennenswert verändert hatte; Harris´
Fernheiler hingegen erhielten kein derartiges Feedback. Der Teamleiter gab den Vornamen des zugeteilten Patienten sogleich an die übrigen Mitglieder seiner Gruppe weiter - und von da an betete jeder täglich für "eine rasche Genesung" des Betreffenden "ohne Komplikationen", insgesamt 28 Tage lang.
Wie bestimmte Harris den Behandlungserfolg? Dazu ließ er ein Team von Kardiologen und Internisten zwei Bewertungsverfahren entwickeln. Beim ersten wurde einfach
zusammengezählt, wieviele neue Diagnosen, medizinische Vorfälle, ärztliche Verschreibungen und Maßnahmen auf einen Patienten im Behandlungszeitraum entfielen. Beim zweiten wurden solche Ereignisse zusätzlich gewichtet, je nachdem, wie schwerwiegend sie aus ärztlicher Sicht waren. So entstand der MAHI-CCU-Score als bevorzugtes Messinstrument. ("MAHI" steht für Mid America Heart Institute, CCU für coronary care unit.) Wie er bestimmt wird, erläutert Harris an drei Beispielen:
"Wenn ein Patient nach seinem ersten Tag in unserer Herzklinik eine instabile Angina entwickelt (1 Punkt), mit antianginalen Medikamenten behandelt wurde (1 Punkt), einen Herzkatheter eingeführt bekam (1 Punkt), einer erfolglosen Revaskularisation - einem gefäßchirurgischen Verfahren, welches die Durchblutung minderversorgter Gewebe verbessern soll - mit einer perkutanen transluminalen Koronarangioplastie unterzogen wurde (3 Punkte) und anschließend eine Bypass-Operation an der
Koronararterie stattfand (4 Punkte), so lag sein gewichteter MAHI-CCU-Wert bei 10. Bei einem anderen Patienten trat vielleicht Fieber auf, woraufhin er mit Antibiotika behandelt wurde (1 Punkt); falls keine weiteren Probleme auftraten, würde er mit einem Punktwert von 1 aus der Klinik entlassen. Ein dritter Patient könnte einen Herzstillstand erleiden (5 Punkte) und daraufhin sterben (6 Punkte), was einen Wert von 11 ergäbe. Die ungewichteten Werte lägen entsprechend bei 5, 1 bzw. 2."
(Bei Byrd hingegen war der Zustand des Patienten jeweils nur in den drei Kategorien "gut", "mittel" und "schlecht" eingeschätzt worden.) Um die Reproduzierbarkeit dieser Bewertung zu überprüfen, ließ Harris zehn Mediziner - fünf Kardiologen sowie fünf ihrer Assistenten - damit elf zufällig ausgewählte Krankenunterlagen einschätzen; zu über 96 Prozent stimmten sie überein.
Die Auswertung brachte für Harris einen deutlichen Gebetseffekt zum Vorschein: Der
ungewichtete, also rein additive Wert der Fernbehandelten lag um durchschnittlich zehn Prozent unter dem der Kontrollgruppe; beim gewichteten Wert war die Differenz noch ein wenig ausgeprägter, nämlich elf Prozent. Hingegen zeigte sich, wie schon in der Byrd-Studie, kein Unterschied, was die durchschnittliche Länge des Klinikaufenthalts betraf: In beiden Gruppen lag sie bei vier Tagen.
Damit will Harris nicht "bewiesen haben, dass Gott Gebete erhört oder gar, dass es ihn gibt. Es
war die Fürbitte, nicht die Existenz Gottes, die hier getestet wurde. Was wir beobachtet haben, ist allein dies: Wenn einzelne Menschen außerhalb des Krankenhaus den Vornamen eines stationär aufgenommenen Patienten denken oder aussprechen und dabei für ihn beten, scheint es dem Betreffenden dort besser zu ergehen." Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass Harris´ Befunde zufällig zustande kamen, bei 1 zu 25 liegt, "bleibt Zufall doch eine mögliche Erklärung für unsere
Ergebnisse", wie er zurückhaltend resümiert.
Weiter: Geistheilung? Diskussion der Studien von Byrd, Krucoff und Harris
Literaturhinweise in Geistiges Heilen - Das Große Buch sowie Fernheilen, Band 2. | |