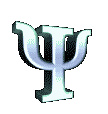Keine sechs Wochen nach Elisabeth Targs Tod, im September 2001, erschien in Amerikas führender Fachzeitschrift für Fortpflanzungsmedizin ein Artikel, den sie sicherlich als Bestätigung und Ermutigung betrachtet hätte. In ihm berichtete ein in Fachkreisen hochangesehener Gynäkologe, Professor Dr. Rogerio Lobo von der Columbia-Universität in New York und Leiter der dortigen Abteilung für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, über eine weitere Fernheilstudie, die mit einem beinahe
unglaublichen Ergebnis aufwartete: Bei Frauen mit bislang unerfülltem Kinderwunsch verdoppelt Fernheilen die Chance, durch künstliche Befruchtung schwanger zu werden.
Die Technik der Befruchtung von Eizellen außerhalb des Mutterleibs, mit anschließender Einpflanzung des Embryos (IVF-ET = In Vitro-Fertilization - Embryo Transfer), hat in den vergangenen zwanzig Jahren deutliche Fortschritte gemacht. Lag die Chance, auf diese Weise schwanger zu werden, in den siebziger Jahren noch
unter zehn Prozent, so stieg sie z.B. in den Vereinigten Staaten bis 1984 bereits auf 21 Prozent und hatte 1997 immerhin 28 Prozent erreicht. In der Cha-Klinik, einem Allgemeinen Krankenhaus in Südkoreas Hauptstadt Seoul, lag sie 1998 sogar bei knapp 33 Prozent. Und eben dort fand, unter Aufsicht des Klinikdirektors Kwang Y Cha, zwischen Dezember 1998 und März 1999 ein Fernheiltest statt, in den 169 Frauen zwischen 26 und 46 Jahren (Durchschnittsalter: 34) einbezogen wurden, bei welchen ein
IVF-ET durchgeführt werden sollte. (Ursprünglich waren 219 Teilnehmerinnen vorgesehen. 50 von ihnen schieden allerdings aus - wegen unvollständiger medizinischer Daten, weil sie ausstiegen oder weil es zu keinem Embryotransfer kam.) Nach einem Zufallsverfahren kamen 88 von ihnen in eine "Fernheilgruppe", 81 weitere in die Kontrollgruppe. Kein Patient wusste von der Zuteilung, ebensowenig wie das Klinikpersonal und zwei Statistiker aus Korea und den USA, die schließlich die
ermittelten Daten auswerteten. Zumindest den Patientinnen war nicht einmal klar, dass die Studie überhaupt stattfand. Bei ihnen allen wurde in der Klinik nach demselben Schema vorgegangen: Zunächst wurden sie mit einem GnRH-Agonisten und Gonadotropinen (in der Regel 3-75 IU Ampullen/d) so lange behandelt, bis mindestens drei Follikel reif waren. Drei Tage nach der Entnahme wurde ihnen der Embryo eingepfanzt.
Ihre Fernheiler waren Kontinente weit von ihnen entfernt: Sie hielten sich in
den Vereinigten Staaten, in Kanada und Australien auf. Alle waren Christen, und alle glaubten an die Heilkraft der Fürbitte. Aus ihnen wurden mehrere Gruppen mit drei bis dreizehn Heilern zusammengestellt, die einander gegenseitig kannten. Von jeweils fünf Frauen, die fernbehandelt werden sollten, erhielt jedes Mitglied einer Heilergruppe binnen fünf Tagen nach der ersten Hormoninjektion Fotos zugesandt, mit der Bitte, für sie fortan drei Wochen lang zu beten; die Fürbitten sollten darauf
ausgerichtet sein, die Schwangerschaftsrate unter den fünf Frauen zu erhöhen. Eine zweite Heilergruppe betete dafür, dass die Gebete der ersten Heilergruppe erhört werden - und dass sich der Wille Gottes im Leben der Patienten erfüllen möge. Eine dritte Gruppe betete, für die Teilnehmer der beiden ersten Gruppen möge eintreten, was dem Willen Gottes entspricht.
Die Ergebnisse verblüfften alle beteiligten Mediziner. In der Gebetsgruppe waren 50 Prozent aller Frauen (44 von 88) schwanger
geworden - in der Kontrollgruppe nur 26 Prozent (21 von 81). Weder das Alter der Frauen, noch Dauer und Art der Unfruchtbarkeit, noch die Anzahl früherer künstlicher Befruchtungsversuche konnte diese Unterschiede erklären, wie die statistische Analyse ergab. Ebensowenig ließen sich die Ergebnisse auf unterschiedliche Vorgehensweisen der sechs Ärzte zurückführen, die die IVF-ETs vornahmen. Am ausgeprägtesten trat der Effekt bei Frauen über dreißig auf - bei jüngeren hingegen waren die
Schwangerschaftsraten in beiden Gruppen annähernd gleich hoch.
Darüber hinaus gelang die Implantaton des Embryos in der Gebetsgruppe mit 16 Prozent deutlich öfter als in der Kontrollgruppe (8 Prozent).
Mehrfachschwangerschaften traten in der Gebetsgruppe weitaus häufiger auf (17 Prozent) als in der Kontrollgruppe (4,9 Prozent).
In der Gebetsgruppe erreichten mehr Zygoten das Achtzell-Stadium als in der Kontrollgruppe (66 gegenüber 45,5 Prozent).
"Wir hätten
diese Befunde ignorieren können", erklärt Professor Lobo, "aber das würde nicht helfen, auf unserem Gebiet voranzukommen. Wir machen unsere Ergebnisse in der Hoffnung öffentlich, dass sie eine Diskussion anstoßen, aus der wir lernen können. Denn wir würden gerne die biologischen oder sonstigen Phänomene verstehen, die zu dieser annähernden Verdopplung der Schwangerschaftsrate geführt haben." Am Ende ihres Forschungsberichts stellen die Autoren klar, dass sie ihre Daten
"als vorläufig betrachten. Wir sind uns vollauf der zahlreichen biologischen Faktoren und unbekannten Variablen bewusst, die am Behandlungsprozess des IVF-ET beteiligt sind", und womöglich liefern sie eines Tages eine plausible Erklärung dessen, was sich in der südkoreanischen Klinik zugetragen hat. Bis dahin bietet die Cha/Lobo-Studie allerdings triftige Gründe, im Fernheilen den ausschlaggebenden Wirkfaktor zu sehen.
Dieser Einschätzung hat sich sogar die Katholische
Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten angeschlossen. Allerdings wirft sie die Frage auf, "ob Gott intervenieren würde, um eine unmoralische Behandlung vorzunehmen ... Doch dies ist eine Frage der Theologie, nicht der Wissenschaft." Unter diesem Blickwinkel kann auch hinterfragt werden, weshalb es sowohl in der Gebetsgruppe als auch in der Kontrollgruppe zu drei spontanen Aborten kam. Jeder dieser sechs traurigen, Verzweiflung auslösenden Fehlschläge war wohl weder im Sinne der
Betenden noch dessen, der sie erhören sollte.
Von unbekannten biologischen Faktoren abgesehen muss, wie bei allen Studien zum Fernheilen durch Gebet, auch das bereits erwähnte Problem des background praying mitbedacht werden. Nicht nur die Fernheiler beteten für die Frauen in Seoul, die sich sehnlichst ein Kind wünschten - auch diese selbst taten es vermutlich vielfach, ebenso wie ihre Angehörigen und Freunde. Dass dieser nicht zu kontrollierende Einfluss die Ergebnisse verzerrt haben könnte, kann zumindest niemand ausschließen, der überhaupt mit der Macht des Gebets rechnet.
Weiter: Therapeutic Touch-Studien - Geistiges Heilen nach D. Krieger
Literaturhinweise in Geistiges Heilen - Das Große Buch sowie Fernheilen, Band 2. | |