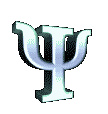|
Beten ist gut fürs Herz: Byrds Befund sogleich zu überprüfen, hätte sich eigentlich jeder Kardiologe herausgefordert fühlen müssen, der seinen Patienten möglichst effektiv, preiswert und nebenwirkungsfrei helfen will. Doch verstrichen dreizehn Jahre, ehe eine ähnlich angelegte Studie an die Pioniertat von San Francisco anknüpfte. Das Ergebnis wurde im Herbst 1998 bei der 71. Jahrestagung der American Heart Association in Dallas, Texas,
präsentiert und drei Jahre später im American Heart Journal publiziert8 - just bei der gleichen Veranstaltung, auf der Byrd 1985 der Fachwelt seine Arbeit erstmals zur Kenntnis gebracht hatte. Ein neunköpfiges Medizinerteam unter Leitung von Professor Dr. Mitchell W. Krucoff vom Institut für Klinische Forschung der Duke-Universität in Durham, North Catolina, hatte dafür 150 Patienten gewonnen, die an akuten Koronarsymptomen litten. Bei einem Großteil von ihnen lag eine Angina pectoris vor
(von lat. angere: verengen, erdrosseln; pectus: Brust): eine akute Koronarinsuffizienz, für die plötzlich einsetzende, mehrere Sekunden bis Minuten anhaltende heftige Schmerzen im Brustbereich, auch im Ruhezustand, charakteristisch sind; diese Schmerzen können in Schulter, Arm und Hand ausstrahlen, ebenso in den Hals-Unterkiefer-Bereich. Betroffene spüren eine Enge, so als würde ein Gürtel um ihren Brustkorb zusammengezogen; es kommt zu Atemnot und Erstickungsgefühlen, die meist Todesangst
heraufbeschwören. Solche Beschwerden treten immer dann auf, wenn das Herz mit zuwenig Sauerstoff versorgt wird. Häufig sind dabei die Herzkranzgefäße infolge von Kalkablagerungen verengt, so dass nicht mehr genügend sauerstoffhaltiges Blut hindurchfließen kann. Allen Versuchspersonen Krucoffs stand eine invasive Angiographie bevor, eventuell mit anschliessender Herzoperation. (Bei der Angiokardiographie handelt es sich um eine Röntgenkontrastdarstellung der Herzhöhlen und der großen Gefäße,
wofür zuvor ein Herzkatheter gelegt wird; damit können unter anderem Form, Größe und Veränderungen der Herzklappen sowie die Beschaffenheit der Herzkranzgefäße beurteilt werden.)
Diese 150, im Durchschnitt 64 Jahre alt, wurden nach dem Zufallsprinzip in fünf Gruppen zu je dreißig Versuchspersonen aufgeteilt. Die erste erlernte und praktizierte Entspannungsübungen; die zweite erhielt eine "Berührungstherapie", die eine besonders liebevolle, körperbetonte Pflege einschloss; dabei
hielten Krankenpfleger öfters die Hände der Patienten und streichelten sie. Eine dritte Gruppe arbeitete mit Imaginationen, bildhaften Vorstellungen. Weitere dreißig Patienten wurden der Kontrollgruppe zugelost, die lediglich nach schulmedizinischem Standard versorgt wurde. Für die übrigen dreißig wurde gebetet, und zwar unter Doppelblindbedingungen: Weder die Patienten noch ihre Ärzte oder das Pflegepersonal wussten davon. Die Fernheiler repräsentierten denkbar unterschiedliche Traditionen
und waren über mehrere Kontinente verteilt: darunter 150 buddhistische Mönche im Kopan-Kloster in Nepal und weitere 18 im Nalanda-Kloster in Frankreich, 17 Mönche vom katholischen Karmeliter-Orden im US-Bundesstaat Maryland, mehrere orthodoxe Juden in Jerusalem sowie vier Glaubenskongregationen von Baptisten, Moravianern und dem "Abundant Life Center" in Sanford, North Carolina, einer Vereinigung christlicher Fundamentalisten.
Um festzustellen, wie sich die jeweilige
Therapieform auswirkte, wurden bei allen Versuchspersonen regelmäßig Blutdruck und Herzschlag gemessen, ein EKG (Echokardiographie) sowie vielerlei weitere Abklärungen vorgenommen. Außerdem protokollierte das Pflegepersonal fortlaufend alle gesundheitlich bedeutsamen Ereignisse.
Wie sich herausstellte, halfen sämtliche eingesetzten Zusatztherapien signifikant: Sie reduzierten die Häufigkeit von Komplikationen um 25 bis 30 Prozent. Am meisten aber nützte offenbar die christliche Fürbitte:
| |