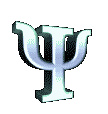|
Bei allem Respekt vor Byrds, Krucoffs und Harris´Courage, ihre aufwendigen Studien inmitten von Hochburgen der US-amerikanischen Schulmedizin zu wagen, unberührt von hämischer Kollegenschelte: Auch sie sind nicht unanfechtbar.
-
Wir wissen nichts über die unterschiedlichen Fähigkeiten und Behandlungsgewohnheiten der beteiligten Ärzte. Manche neigen rascher als andere dazu, Medikamente zu verabreichen; manche sind schneller dabei, ihre Patienten über eine künstliche Luftröhre mechanisch zu beatmen; manche halten sie länger in der kardiologischen Abteilung fest als andere. Ist auszuschließen, dass sich um die Gebetsgruppe weniger interventionsfreudige Ärzte gekümmert hatten? Dann würde beispielsweise der seltenere Einsatz von Medikamenten und Notfallmaßnahmen nicht etwa die Fernwirkung des Betens widerspiegeln, sondern konservativere Verschreibungsgewohnheiten.
- Ebensowenig wissen wir darüber, wie die Patienten der kardiologischen Abteilung ihre Lage im Testzeitraum psychisch verarbeitet haben. Untersuchungen von Harvard-Medizinern belegen, dass die wirksamste Bewältigungsstrategie während der ersten 24 Stunden nach einem Herzanfall in der Verleugnung besteht: Wer das Geschehene verdrängt, hat seltener Herzrhythmusstörungen - und ein geringeres Todesrisiko. Sollten in Byrds, Krucoffs und
Harris´ Gebetsgruppen "Verdränger" überrepräsentiert gewesen sein, so ließen sich die festgestellten Differenzen zur Kontrollgruppe zumindest teilweise darauf zurückführen.
- Fielen die Unterschiede zwischen Fernheilungs- und Kontrollgruppe wirklich ausgeprägt genug aus? In beiden Byrd-Gruppen beispielsweise mussten nahezu gleich viel Medikamente ausgegeben werden, und auch die Gesamtzahl der verbrachten Tage im Krankenhaus
und speziell in der kardiologischen Abteilung war annähernd dieselbe. In der Gebetsgruppe waren nur sieben Prozent weniger Antibiotika und fünf Prozent weniger Diuretika erforderlich; Fälle eines durch Blutstau verursachten Herzversagens kamen nur zu sechs Prozent seltener vor, Fälle von Herz-Lungen-Versagen lediglich zu fünf Prozent. "Einige Zyniker", fasst der amerikanische Alternativmediziner Larry Dossey zusammen, "haben festgestellt, dass solche geringfügigen
Verbesserungen nicht auf die Macht Gottes, sondern auf seine Schwäche hinweisen ... Wenn Fernheilung durch Gebet wirkt, würde man deutlichere Beweise erwarten als ein paar wenige Prozentpunkte der Besserung."
- Niemand weiß, ob und wieviel die Patienten in den Experimental- und Kontrollgruppen für sich selbst beteten, oder in welchem Maße es Angehörige, Freunde und Außenstehende für sie taten. "Es wurde kein Versuch
unternommen, Gebete in der Kontrollgruppe einzuschränken", räumt Byrd selbst ein und merkt zurecht an: "Ein solches Vorgehen wäre sicherlich unethisch und wahrscheinlich auch unmöglich durchzuführen." Auch Harris schränkt ein: "Da über die Hälfte der Patienten, die zu uns ins Hospital kamen, sich als religiös bezeichneten, sind wahrscheinlich für viele, wenn nicht die meisten in beiden Gruppen, während sie bei uns waren, Gebete von Freunden, Angehörigen und Geistlichen
gesprochen worden. Somit gab es für beide Gruppen ein unbekanntes, nicht zu kontrolliertes Ausmaß an "Beten im Hintergrund" (background prayer), von dem wir nur vermuten können, dass es gleich groß war. Dann aber existierte womöglich überhaupt keine wirkliche Kontrollgruppe. Dies wiederum lädt zu einem blasphemischen Gedankenspiel ein: Gesetzt den durchaus möglichen Fall, dass durch Außenstehende oder die Betroffenen selbst unbemerkt mehr für die Kontrollgruppe gebetet worden
ist, so hätte Byrd nachgewiesen, dass Beten eher schadet.
- Hinzu kommen religiöse und ethische Bedenken. Verdienten es die Patienten in der Kontrollgruppe etwa nicht genauso, geheilt zu werden, wie diejenigen in der Gebetsgruppe? Würde Gott eine Gruppe gegenüber der anderen bevorzugen, um das Forschungsinteresse von ein paar US-amerikanischen Kardiologen zu befriedigen, so würfe dies einen Schatten auf seine Vollkommenheit. Und
ist es nicht überhaupt unethisch, Schwerkranken allein zu wissenschaftlichen Kontrollzwecken über ein Dreivierteljahr lang eine Therapieform vorzuenthalten, von deren Wirksamkeit der gläubige Christ Byrd schon überzeugt war, ehe der Versuch begann? Wer meint, Schwerkranken mit einer Therapie helfen zu können, ist moralisch verpflichtet, sie möglichst rasch möglichst vielen zugänglich zu machen, anstatt zu selektieren - mit welchen Rationalisierungen auch immer -, wer sie bekommt und wem sie
vorenthalten wird.
- Gebete können spezifisch sein, mit ganz bestimmten Anliegen - oder ungerichtet ("Dein Wille geschehe"). Byrd, Krucoff und Harris gaben den beteiligten Heilern zwar ausdrücklich vor, für eine "rasche, möglichst komplikationsfreie" Genesung zu beten; eine Kontrolle jedoch, ob sich die Fernbehandler tatsächlich daran hielten, fand nicht statt. Vielen Gläubigen widerstrebt es indes, an Gott
überhaupt irgendwelche konkreten Wünsche heranzutragen; sie überlassen es dem Höchsten zu entscheiden, was für einen Kranken das Beste ist. Doch "das Beste" kann manchmal der Tod sein, nicht das Weiterleben - etwa wenn ein Patient von fürchterlichen Schmerzen gequält wird, keine Aussicht auf Heilung mehr besteht und alle Medikamente unwirksam geworden sind, so dass der Rest des Daseins voraussichtlich nur noch zu einer einzigen Qual wird. Insofern taugt eine geringere
Sterblichkeitsrate in den Experimentalgruppen der drei Studien schwerlich dazu, die Macht der Fernheilung durch Gebet zu beweisen.
Weiter: Die Wirth-Studie - Geistiges Heilen bei postoperativen Schmerzen
Literaturhinweise in Geistiges Heilen - Das Große Buch sowie Fernheilen, Band 2. | |