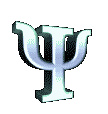Bei aller Euphorie über mindestens ein Dutzend Fernheilstudien mit positivem Ausgang, die durchaus höheren wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, darf nicht übersehen werden, dass sie aus einer Fülle von Minderwertigem herausragen. Selbst einige vermeintlich
"erfolgreiche" Doppelblindstudien, die in der Heilerszene, der Esoterikpresse und populärer Psi-Literatur seit Jahrzehnten zu "schlagenden Beweisen" hochgejubelt werden, weisen in Wahrheit gravierende Mängel auf. Das gilt insbesondere für die beiden allerersten Doppelblindstudien zum Fernheilen, die in den sechziger Jahren stattfanden: denen von Joyce/ Welldon (1965) und Collipp (1969).
Das erste Experiment, in dem heilsame Gebetseffekte unter Doppelblindbedingungen
geprüft wurden, unternahmen Anfang der sechziger Jahre die Psychopharmakologen C. Joyce und R. Welldon am London Hospital Medical College.34 Dabei konzentrierten sie sich auf Fälle von Gelenkserkrankungen sowie psychischen Störungen. Aus Betroffenen stellten sie matched pairs zusammen: Vergleichspaare, deren Beteiligte hinsichtlich Alter, Geschlecht und klinischer Diagnose zueinander "passten". Für jeweils eine Person eines Vergleichspaars sprachen christliche Gebetsgruppen in
mehreren Städten Großbritanniens ein Gebet, in Verbindung mit einer Meditation über ein ausgewähltes Bibelzitat; währenddessen versuchten sich die Betenden den jeweiligen Kranken in der Vorstellung auszumalen. Worum es in der Studie ging, wussten die Versuchspersonen nicht - ebensowenig wie ihre behandelnden Ärzte, die den beiden Forschern in regelmäßigen Abständen Bericht erstatteten, wobei sie den Gesundheitszustand ihrer Patienten auf einer Zahlenskala einschätzten.
Die
anfänglichen Ergebnisse fielen ermutigend aus: Unter den ersten sechs Patientenpaaren ging es nach einem halben Jahr den Fernbehandelten immerhin allesamt deutlich besser als der jeweiligen Kontrollperson. Merkwürdigerweise kehrte sich dieses Verhältnis aber nahezu um, als Joyce und Welldon ihre Studie mit sechs weiteren Patientenpaaren fortsetzten: Diesmal schienen die Versuchspersonen der Kontrollgruppe in fünf von sechs Fällen die größeren Fortschritte gemacht zu haben.
Man muss
nicht erst mit klerikalen Geistern mutmaßen, der Allmächtige richte sich, wenn er Gebete erhöre, wohl kaum nach irgendjemandes Forschungszielen. Die Joyce/Welldon-Studie war von vornherein derart mangelhaft angelegt, dass sie ebensowenig beweist wie widerlegt. "These results may be due solely to chance", räumen die Autoren selbst ein, und damit könnten sie recht haben: Statt sich auf ein einzelnes, klar umrissenes Krankheitsbild zu konzentrieren, bezogen sie ganz allgemein Patienten
ein, die an "chronisch stillstehenden oder sich fortschreitend verschlimmernden Erkrankungen" litten, "entweder an psychiatrischen oder an Gelenkserkrankungen wie beispielsweise rheumatoide Arthritis". Nach welchen Maßstäben aus derart unspezifischen Kategorien Paare gebildet wurden, verschweigen Joyce und Welldon; auch unterschlagen sie nähere Angaben über die genaue Art der beobachteten "psychiatrischen" und Gelenkserkrankungen. Ebensowenig erfährt man von
ihnen über die klinischen Kriterien, nach denen die beteiligten Ärzte ihre Einschätzungen vornahmen: In welchem Sinne, in welchen Hinsichten ging es Versuchspersonen mehr oder minder gut? Gesundheit ist ein Zustand mit mehr als einer Dimension. Und wie konnte man sich von einer derart kleinen Stichprobe überhaupt allgemeinere Einsichten versprechen?
Schlechte Vorbilder regen gelegentlich dazu an, es besser zu machen, und zumindest insofern hat sich die Joyce/Welldon-Studie verdient
gemacht. Vier Jahre nach ihrer Veröffentlichung gab sie dem amerikanischen Arzt Dr. Platon Collipp den Anstoß dazu, eine sorgfältiger vorbereitete Wiederholung zu versuchen, dessen Versuchsplan "klarer"sein sollte als der "zu komplexe" seiner Londoner Kollegen.35 Collipp, Leiter der Kinderstation am Meadowbrook Hospital in New York, konzentrierte sein Projekt auf eine Krankheit mit einer hinlänglich abgesicherten, damals in der Regel auf sicheren Tod hinauslaufenden
Verlaufsprognose: auf Leukämie bei Kindern. Aus achtzehn betroffenen Kindern, die "in ähnlicher Weise" chemotherapiert wurden, wählte er zehn aus, für die fortan zehn Gebetsgruppen - gläubige Familien im US-Bundesstaat Washington - Gottes Gnade erbitten sollten. Dazu wurde ihnen jeweils nur der Name eines Kindes mitgeteilt, nichts weiter. Weder die behandelnden Ärzte noch die Kinder und ihre Angehörigen wussten, in was für eine Untersuchung sie da einbezogen waren. Bei Testende,
nach fünfzehn Monaten, waren von den zehn solchermaßen Fernbehandelten immer noch acht am Leben; in der Kontrollgruppe hingegen waren sechs der acht Kinder ihrer Leukämie inzwischen erlegen. Überdies sollen die überlebenden Mitglieder der Experimentalgruppe im Durchschntt in einer deutlich besseren Verfassung gewesen sein als ihre Schicksalsgefährten aus der Kontrollgruppe, wie die ärztlichen Beurteilungen zu belegen schienen.
Trotzdem ist diese gutgemeinte Studie beinahe wertlos. Denn
sie berücksichtigte weder, dass die Kinder an unterschiedlichen Arten von Leukämie litten (mit stark unterschiedlichen statistischen Überlebenszeiten), noch ihre unterschiedliche medikamentöse Behandlung, während der Versuch lief. (Während alle Kinder der Experimentalgruppe von lymphatischer Leukämie betroffen waren, litten zwei Kinder der Kontrollgruppe an einer bösartigeren, erheblich letaleren Form, der myeloischen; sie starben binnen zwei bzw. fünf Monaten.) Ebensowenig stellte Collipp
sicher, dass beide Gruppen von Kindern hinsichtlich ihres Alters, ihres Geschlechts und vor allem ihres Krankheitsstadiums überhaupt miteinander vergleichbar waren. Es wurde nicht einmal überprüft, ob und wie oft für die Kinder tatsächlich gebetet wurde. Zudem war Collipps Stichprobe viel zu klein, um allgemeine Schlüsse zu erlauben.
Mit Vorsicht zu genießen ist auch ein vermeintlicher "Beweis", dass Fernheilen gegen Bluthochdruck helfe - geführt von Robert N. Miller in einer
Untersuchung, über die er 1982 in der Fachzeitschrift Medical Hypotheses berichtete.36 Miller hatte 96 Patienten mit Bluthochdruck, zwischen 16 und 60 Jahren alt, in zwei Gruppen aufgeteilt: Um die eine Hälfte kümmerten sich eine Zeitlang acht Fernheiler in der Tradition der amerikanischen "Church of Religious Science", die andere diente währenddessen zur Kontrolle. Auch während die Studie lief, wurden die beiden Gruppen wie bisher schulmedizinisch betreut und behandelt. Weder die
Ärzte, die den Blutdruck aller Versuchspersonen regelmäßig kontrollierten, noch die beteiligten Patienten wussten, wer fernbehandelt wurde. Trotzdem wiesen die Fernbehandelten bei Testende im Durchschnitt einen deutlich niedrigeren systolischen Blutdruck auf. Um den arteriellen Blutdruck zu messen, wird üblicherweise zunächst eine leere Gummimanschette, die mit einem Manometer (einem Druckmessgerät) verbunden ist, um den Oberarm gelegt. Dann wird die Manschette so lange aufgepumpt, bis der
Blutstrom in der Armschlagader völlig abgedrosselt und der Pulsschlag nicht mehr zu tasten ist. Wird der Manschettendruck wieder vermindert, so ist durch ein Stethoskop, das im Bereich der Ellenbeuge aufgesetzt wird, zu hören, wie das Blut wieder in die Armarterie einfließt. Der dabei abgelesene Manometerwert zeigt den systolischen oder Spitzendruck an, z.B. 120 mm Quecksilber. Das pulssynchrone Geräusch verschwindet, wenn der Manschettendruck weiter verringert wird - dann kann der
diastolische oder Taldruck (z.B. 80 mm Quecksilber) abgelesen werden.
Nicht verschwiegen werden darf, dass in Millers Studie beim diastolischen Blutdruck die Fernheilgruppe keineswegs im Vorteil war. Und auch bei der Herzfrequenz blieb ein Fernheileffekt aus. Das Hauptmanko der Studie besteht darin, dass versäumt wurde, die Medikation zu kontrollieren. Deshalb könnten die festgestellten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen allein daher rühren, dass die Fernbehandelten die besseren
Arzneimittel schluckten.
Weiter: Studien zum Phänomen Geistiges Heilen mit negativem Ausgang
Näheres in Geistiges Heilen - Das Große Buch sowie Fernheilen, Band 2.
| |